Das Umgangsrecht ist ein Begriff des Familienrechts und im Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) geregelt. Das Kind hat ein Recht auf Umgang mit beiden Elternteilen und weiteren nahestehenden Personen (z.B. Großeltern, Geschwister); gleichzeitig sind die Eltern zum Umgang berechtigt und verpflichtet.
Wird dieser Kontakt zum Kind oder zur Bezugsperson unrechtmäßig verweigert, so kann der Umgang gerichtlich erzwungen werden. Der Gesetzgeber sieht hierbei einen Anspruch auf die gerichtliche Einforderung des Umgangs für all jene Personen vor, die grundsätzlich einen Rechtsanspruch auf Umgang haben.
Somit steht der Klageweg einerseits den Rechtsvertretern des Kindes, den Eltern wie auch Großeltern zu. Personen aus dem engeren Umfeld des Kindes hingegen, können nur im Ausnahmefall einen Anspruch auf Umgang gerichtlich durchsetzen.
Eine individuelle Umgangsvereinbarung der Eltern oder eine gerichtliche Entscheidung regelt, wie häufig der nicht betreuende Elternteil das Kind sehen darf. Werden die einvernehmlichen Regelungen der Eltern nicht eingehalten oder erhält der Elternteil nicht genügend Umgang mit dem Kind, z.B. nur 2 Stunden jedes dritte Wochenende, obwohl ihm alle zwei Wochen ein ganzes Wochenende zustehen würde, dann kann der Elternteil das Umgangsrecht einklagen. Bei der Entscheidung des Gerichts spielt das Alter des Kindes, seine Entwicklung sowie die Bindung zum Elternteil eine wichtige Rolle. Je älter das Kind ist, desto länger kann der Kontakt stattfinden. Dies ist eine gängige Regelung für die verschiedenen Altersklassen:
Wird eine bereits getroffene gerichtliche Umgangsregelung nicht eingehalten, ist der Umgangstitel vollstreckbar.
Um spätere Konflikte zu vermeiden, ist es empfehlenswert, Umgangsvereinbarungen schriftlich festzuhalten und folgende Aspekte zu regeln:
Je genauer die Vereinbarungen formuliert sind, desto besser ist dies, um Streitereien zu vermeiden.
Selbst bei einem freundschaftlichen Verhältnis der Eltern, ist eine schriftliche Vereinbarung sinnvoll, um im Streitfall einen vollstreckbaren Umgangstitel einklagen zu können. Bestenfalls befinden sich die Vereinbarungen auf einem unterschriebenen Schriftstück und nicht in E-Mails oder Textnachrichten.
Es kann unterschiedliche Gründe geben, warum es sinnvoll sein kann, das Umgangsrecht einzuklagen. Meist muss das Besuchsrecht gerichtlich durchgesetzt werden, wenn sich der betreuende Elternteil nicht an die einvernehmlichen Umgangsvereinbarungen hält und somit den Kontakt zum Kind boykottiert.
Frau Müller und Herr Müller leben seit einiger Zeit getrennt und die gemeinsame Tochter lebt bei der Mutter. Herr Müller hat das Umgangsrecht und hat sich mit seiner Frau darauf geeinigt, dass er die Tochter jedes zweite Wochenende zu sich nehmen darf, Freitag um 16 Uhr abholt und Sonntagabend um 18 Uhr zurückbringt. Allerdings sind weder Mutter noch Tochter freitags um 16 Uhr zu Hause anzutreffen. Nach dem dritten Vorkommnis sowie einer fehlenden Erklärung seiner Frau bzw. Änderungen der Regelung klagt Herr Müller das Umgangsrecht ein.
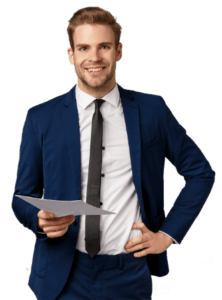
Ein weiterer Grund kann eine vehemente Kontaktverweigerung durch den Elternteil mit der elterlichen Obsorge sein. Es ist jedoch nicht rechtens, dass ein Elternteil dem anderen eigenmächtig den Kontakt zum Kind untersagt. Der Kontakt kann nur bei einer Kindeswohlgefährdung verweigert werden.
Hat der umgangsberechtigte Elternteil eine Umgangsvereinbarung mit dem betreuenden Elternteil getroffen, kann diese vor dem Familiengericht eingesetzt werden. Die Umgangsregelung muss vor Gericht beantragt werden, damit dieses einen Umgangstitel billigt. Mit einem Umgangstitel kann die Umgangsvereinbarung vollstreckt werden. Der betreuende Elternteil erhält ebenfalls den Antrag zugesendet. Liegt dem Gericht noch keine Umgangsvereinbarung der Eltern vor, die eingeklagt und später durchgesetzt werden könnte, muss das Gericht eine Regelung im Verfahren verhandeln und festlegen.
Eine einvernehmliche Umgangsvereinbarung zwischen den Eltern ist nicht vollstreckbar, hierfür ist zunächst ein gerichtlicher Umgangstitel notwendig. Entspricht die von den Eltern vorgelegte Umgangsregelung dem Kindeswohl, wird der Antrag gebilligt. Verweigert das Kind den Kontakt mit dem umgangsberechtigten Elternteil, muss dieses zunächst prüfen, ob der Wille beachtet werden muss oder nicht. Je älter das Kind ist, desto mehr Mitspracherecht hat es. Durch den gerichtlich gebilligten Umgangstitel ist der Titel vollstreckbar.
Um eine gerichtliche Vollstreckung des Besuchsrechts zu verhindern, kann ein gerichtliches Vermittlungsverfahren eingeleitet werden, bei dem zwischen den Eltern vermittelt wird, sodass eine einvernehmliche Lösung erarbeitet wird. Weigert sich demnach der Elternteil immer noch den Kontakt zu gewähren oder Vereinbarungen einzuhalten, kann der Umgangstitel gerichtlich vollstreckt werden, um somit das Besuchsrecht durchzusetzen. Zuwiderhandlungen werden mit Geldstrafen geahndet.
Erfolgt die Vollstreckung eines Umgangstitels, darf das Gericht bei einer Zuwiderhandlung ein Ordnungsgeld verhängen. Verweigert der betreuende Elternteil immer noch den Kontakt mit dem Kind, kann dies schlimmstenfalls zu einer Ordnungshaft führen. Bevor gegen den umgangsverweigernden Elternteil vollstreckt wird, muss er angehört und auf die Folgen der Zuwiderhandlung hingewiesen werden. Gewährt ein Elternteil keinen Kontakt, muss es damit rechnen, dass das Umgangsrecht mit Zwang durchgesetzt wird. Wurde das Umgangsrecht mutwillig vereitelt, kann dies Auswirkungen auf das Sorgerecht haben. Ein vollständiger oder teilweiser Entzug des Sorgerechts ist hierbei denkbar. Ferner kann eine Ergänzungspflegschaft bestellt werden.
Wie lange es dauert, das Umgangsrecht einzuklagen, ist abhängig vom individuellen Einzelfall und der Auslastung der Gerichte. Gerichtliche Verfahren, die den Umgang regeln, können 4-6 Wochen dauern, aber auch mehrere Monate und mitunter Jahre. Dies kann unterschiedliche Ursachen haben und einerseits an nicht interessierten betreuenden Elternteilen und ihren Rechtsanwälten liegen und andererseits an einer immensen Auslastung der Familiengerichte. Um den betroffenen umgangsberechtigten Elternteilen und Kindern Zumutungen zu ersparen, wäre die Festlegung einer gerichtlichen Mindestzeit für die Entscheidungsfindung wünschenswert.
Nicht immer geht es darum, dass der betreuende Elternteil nicht die Vereinbarungen einhält oder das Umgangsrecht verweigert. In einigen Fällen möchte der betreuende Elternteil, dass der umgangsberechtigte Elternteil sich an die Vereinbarungen hält und das Umgangsrecht durchsetzen. Meist wünscht die Mutter, dass der Vater das Umgangsrecht mit dem Kind gewissenhaft pflegt. Doch kann man den Vater dazu zwingen?
Prinzipiell kann man den umgangsunwilligen Elternteil verpflichten, den Kontakt mit dem Kind zu pflegen, sofern dies dem Kindeswohl entspricht. Muss das Umgangsrecht jedoch unter Zwang fortgesetzt werden, ist es fraglich, ob dies der Entwicklung des Kindes dienlich ist. Häufig verweigern umgangsunwillige Elternteile nicht den Umgang, sondern sind lediglich unzuverlässig und müssen an ihre Umgangspflicht und verantwortungsbewusste Einhaltung der Vereinbarungen erinnert werden. Bevor eine Klage eingereicht wird, sollte eine Drohung zur Durchsetzung des Rechts ausreichend sein, um Wirkung zu erzielen.
Es ist nicht sinnvoll, das Umgangsrecht einzuklagen, wenn das Kind keinen Kontakt wünscht. Man darf ein Kind nicht zum Kontakt zwingen, wenn es diesen nicht wünscht. Dies stellt eine Missachtung des Kindeswillens dar und bedeutet letztendlich eine Kindeswohlgefährdung. Verwehrt ein Kind den Kontakt zum anderen Elternteil, muss hinterfragt werden, warum dies so ist. Gegen den Willen eines Kindes zu entscheiden, kann aber unter Umständen in manchen Fällen notwendig sein – und zwar dann, wenn eine Beeinflussung durch Dritte vorliegt. Dann ist der Kindeswille vor Gericht nicht zu berücksichtigen. Somit stimmt der Kindeswille nicht immer mit dem Kindeswohl überein.
Nichtsdestotrotz hat das Kind auch einen eigenen Willen, der Gehör finden sollte. Je älter das Kind ist, desto mehr ist sein Wille bei der Umgangsentscheidung zu berücksichtigen. Es ist eine selbstständige und eigenverantwortliche Person, die ihr Leben selbst bestimmen kann und Entscheidungen treffen darf, die letztendlich von Erwachsenen akzeptiert werden. Daher gilt zu prüfen, ob die Ablehnung des Kindes seine eigene Entscheidung ist oder nicht. Es gibt die Möglichkeit, den Kontakt unter Beisein des Jugendamtes an einem neutralen Ort stattfinden zu lassen.
Die Gerichtskosten bestimmen sich nach dem Streitwert, wobei Gebühren anfallen, die im Gerichtskostengesetz (GKG) geregelt sind. Die Rechtsanwaltskosten werden nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) berechnet. Erfolgt das Umgangsrechtsverfahren als Folgesache in einem Scheidungsverfahren wird ein Streitwert von rund 900 € bemessen; bei einem selbstständigen Verfahren 3.000 € und bei einstweiliger Anordnung 1.500 €. Erfahrungsgemäß wird die Regelung des Umgangs in erster Instanz mit einem Gegenstandswert von 3.000 Euro bemessen. Demnach ergeben sich folgende Kosten:
Kann ein Elternteil nach seinen persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnissen die Kosten der Prozessführung nicht, nur zum Teil oder nur in Raten aufbringen, erhält er auf Antrag Prozesskostenhilfe. Dies ist aber nur der Fall, wenn das Rechtsverfahren hinreichend Aussicht auf Erfolg bietet und nicht mutwillig ist. Sollten Sie einen Rechtsanwalt beauftragen, lassen Sie sich einen unverbindlichen Kostenvoranschlag geben. Bei Bedarf können Sie:
Bei Gerichtsverfahren vor dem Familiengericht ist Fachwissen gefragt, daher ist ein Anwalt für Familienrecht durchaus sinnvoll. Ein Anwalt kann Ihnen behilflich sein, das Umgangsrecht gerichtlich und außergerichtlich durchzusetzen und Anträge bei der Rechtsantragsstelle einzureichen. Außerdem erhalten Sie eine ausführliche Rechtsberatung und Unterstützung bei der Geltendmachung Ihres Besuchsrechts. Sollten noch keine Umgangsvereinbarungen mit dem anderen Elternteil vorliegen, kann ein Anwalt gegebenenfalls bessere Regelungen für sie aushandeln. Durch eine professionelle Rechtsunterstützung haben Sie bei Verteidigung der Gegenseite eine stärkere Position vor Gericht.
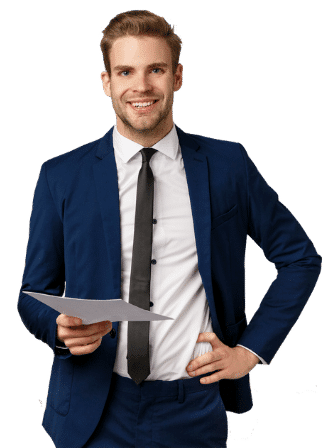
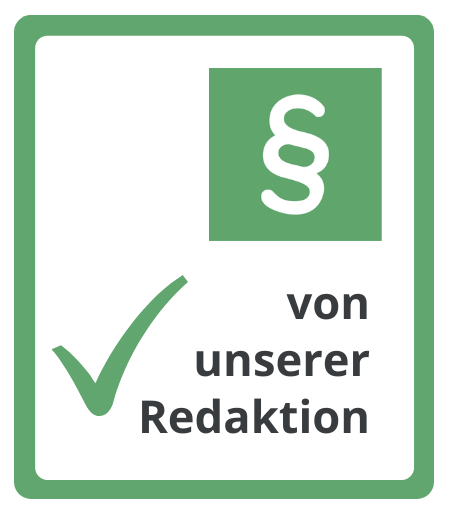
Unsere juristische Redaktion erarbeitet jeden Artikel nach strengen Qualitätsrichtlinien hinsichtlich Inhalt, Verständlichkeit und Aufbereitung der Informationen. Auf diese Art und Weise ist es uns möglich, Ihnen umfassende Informationen zu unterschiedlichsten Rechtsthemen zu bieten, die jedoch lediglich eine erste Information darstellen und keine anwaltliche Beratung ersetzen können.
Wenn Sie dieses YouTube/Vimeo Video ansehen möchten, wird Ihre IP-Adresse an Vimeo gesendet. Es ist möglich, dass Vimeo Ihren Zugriff für Analysezwecke speichert.
Weitere Infos finden Sie in unserer Datenschutzerklärung
[finditoo-listing-email-link]